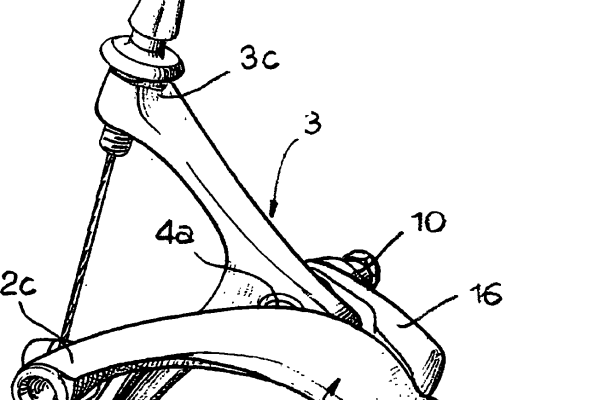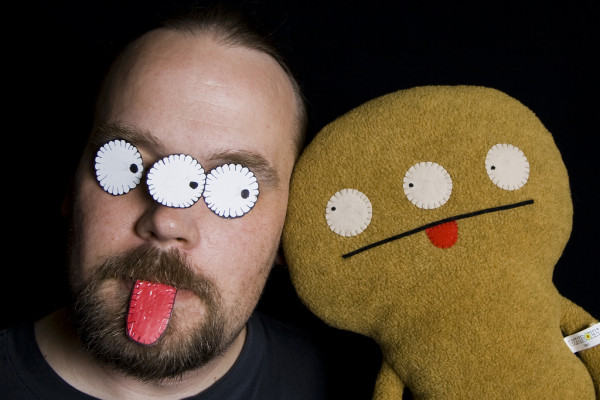Am 28. Juni dieses Jahres ist es 45 Jahre her, dass eine Polizeirazzia in der New Yorker Schwulenbar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street tagelange Straßenschlachten auslöste – der erste Schwulenaufstand der Geschichte sozusagen. Mit dem offenen Kampf traten Schwule endgültig aus dem Halbdunkel der Scham und forderten Anerkennung und Rechte. Seither wird dieser Tag in immer mehr Ländern als Christopher Street Liberation Day mit Paraden begangen, auf denen die schwule Community sich feiert. Im englischsprachigen Raum gab es dafür bald den Begriff „Gay Pride“ (zu deutsch unsäglich „Schwulenstolz“).
Fast ein halbes Jahrhundert später zieht am 13. Juli 2013 eine mit etwas mehr als 1000 Leuten für Berliner Verhältnisse kleine Parade durch Kreuzberg. Ihr Motto: „behindert und verrückt feiern“. Und so tanzen, hinken, zappeln und zucken dann zur Musik Rollstuhlfahrer, Psychopathen, Amputierte, Neurotiker, Spastis, Borderliner, Transidentische und was es nicht alles sonst noch zu diagnostizieren gibt. Natürlich sind auch viele (noch) Nichtdiagnostizierte dabei. Angekündigt ist der Zug als Pride Parade. Die gehaltenen Reden appellieren daran, sich nicht von Normen und allgemeinen Vorstellungen als minderwertig und bedürftig definieren zu lassen. Stattdessen sollte man sich selbst gut finden. Es lässt sich auch feiern, behindert oder verrückt zu sein.
Die Wurzeln reichen bis in die junge Steinzeit
So nah verwandt solche Aufzüge mit neu- zeitlichen politischen Demonstrationen sind, das Paradieren hat Wurzeln, die sich bis in die Antike und sogar darüber hinaus verfolgen lassen. Der Herrscher zeigte sich dem Volk, zog durch‘s Land, begleitet von Edlen, Kämpfern und Tieren. Schätze wurden mitgeführt und Nahrung und Wein an die Leute verteilt. Es wurde gesungen, musiziert und getanzt. In der Frühantike war die Vorstellung verbreitet, dass ein Sieg erst dann errungen war, wenn der Usurpator flankiert von Kriegern mit seinem Streitwagen durchs eroberte Gebiet fuhr. Derlei Umzüge gaben den Leuten Identifikationsmöglichkeiten mit den Herrschern – und umgekehrt.
Dem liegt eine noch ältere Praxis zugrunde: die Prozession. Mit dem Entstehen des Ackerbaus um die späte Steinund frühe Bronzezeit herum scheint sich ein Grundmythos herausgebildet zu haben, der den Kern fast aller antiken Göttererzählungen (auch der christlichen) darstellt. Er ist matriarchaler Natur und geht in etwa so: Die Göttin ist unfruchtbar. Da taucht ein junger Held auf. Oft kommt er
direkt aus dem Himmel. Sie hat ihn für sich bestimmt. Bevor sie es miteinander treiben und sie schwanger wird und gebiert – und meist auch danach – muss er Kämpfe bestehen, Listen erdenken und schier unerledigbar scheinende Aufgaben bewältigen. Letztlich obsiegt das Böse und er wird getötet. Aber sie holt ihn aus der Unterwelt oder dem Himmel zurück, oft, indem er durch sie wiedergeboren wird.
Prunk, Musik und Tanz, Snacks und Drogen
Ursprünglich wurde dieser Mythos so ritualisiert, dass die Göttin von der Hohenpriesterin verkörpert wurde und der Held vom König. Das war nicht unbedingt ein politisches Amt, sondern eher magisch aufgeladen. Zu Beginn des Frühlings fuhr er mit Prunk, Musik und Tanz, Snacks und Drogen durch die Gefilde und segnete sie – sprich: machte sie fruchtbar. Am Ende des Winters wurde er dann geopfert. Das Königtum war mancherorts mit der Gewissheit verbunden, rituell tatsächlich getötet zu werden. Das Opfer war das Heiligste, was es auf Erden geben konnte. Es war der Inbegriff des Göttlichen, das sein Leben gab, damit die Erde, die Tiere und Menschen erlöst und lebendig werden konnten. Mit Prozessionen wurde es allen gezeigt, das Heilige ins Profane getragen und seine Hoheit darüber manifest.
Aneignung von Macht durch Identifikation
Die Manifestation von Macht geschah durch Identifikation. Die Leute waren ergriffen von den Heldentaten und der Opferbereitschaft. Goldene Rüstungen und blitzende Waffen, Pfauen und Leoparden beeindruckten. Die Schönheit der Gesänge und die schmackhaften Speisen betörten. Aus dem König wurde ihr König. Nun erst war er wirklich der Souverän.
Jahrtausende später speist sich die Wirkung einer Pride Parade noch immer daraus. Es geht um Definitionsgewalt, Normalität und Teilhabe. Jetzt ist es nicht mehr ein Eroberer im herkömmlichen Sinn, sondern eine Randgruppe, die dabei ist, die Mitte einzunehmen. Entscheidende Schlachten – beileibe nicht die letzten – sind schon geschlagen, die mit dem Anpassungsdruck und den Zuschreibungen, der Polizei und den Ämtern. Ging es bei Demos, Straßenschlachten, Besetzungen und Verhandlungen um das Erringen und Innewerden von Macht, geht es nun darum, dem Volk Hoheit zu demonstrieren.
Es ist zunächst die Hoheit der Gruppierung über sich selbst. Bis zu den ersten Gay Prides wurde Homosexualität selten offen gelebt, nicht einmal in den Großstädten der westlichen Welt. Die Deutungsgewalt oblag der Mehrheit. Gleichgeschlechtliches Begehren wurde als widernatürlich und kriminell bewertet. Es gab lediglich eine Subkultur – weitgehend unsichtbar und nicht ohne weiteres zugänglich. Das änderte sich nun. Das bis dahin Peinliche ging in die Öffentlichkeit. Schrille Fröhlichkeit; Kajal in bärtigen Gesichtern; High heels an Männerfüßen; schöne Männer, muskulös und jugendlich; manche mädchenhaft; Tunten und Schwuchteln.
Die Umkehr von Scham in Stolz ist die Erlangung der Macht, sich selbst zu definieren. Das kann nur über die Identifikation mit der Gruppe funktionieren. Nur wer sagt „Ich bin schwul“, kann auch sagen „und das ist gut so!“. Gleichzeitig wendet er fraglos die Kategorie auf sich an, die geschaffen wurde, Leute wie ihn von der Normalität zu separieren.
Spätestens hier kommt die Hoheit über die Masse ins Spiel. Jede Anerkennung von Sexualität jenseits hergebrachter Heteronormativität, ihre Gleichbewertung gar, verändert den Umgang mit Sexualität in der Breite.
Briefmarkenbreit dazugehören
Mittlerweile haben schwule und lesbische Promis in Kunst und Politik sogar einen besonderen Glamourfaktor. Die Subkulturen der Gleichgeschlechtlichkeit laufen in die bürgerlichen Ehehäfen ein und arbeiten nun eifrig daran mit, das Bollwerk der Normalität zu festigen. Die Behinderten und Verrückten werden es da schwerer haben.
Einschränkungen lassen sich weniger mit Lust und Glamour besetzen als Sexualität. Eine Subkultur, aus der heraus agiert und an die angeknüpft werden kann, gibt es nicht. Die Behinderten und Verrückten wollen ja gerade nicht mehr unter sich sein, denn das bedeutet Anstalt, geschützte Werkstatt, Therapiegruppe, das bedeutet Internierung und Isolation – die von alters her zugewiesenen Plätze.
Den Kreuzberger Paradierenden jedenfalls fliegen die Herzen des Volkes zu. Die Passanten, die Fenstergäste und die Cafébesucher sind hingerissen. Wer laut und schräg mit Macke und Rollstuhl unterwegs ist, wer Lebensfreude und Selbstbehauptung zeigt, obwohl er bis zum Scheitel mit Entsagung und Unfähigkeit zugeschüttet ist, beeindruckt. Natürlich zielt auch dieser Zug in die Mitte des Mainstreams. Zumindest die Behinderten – den Verrückten wird es schwerer fallen, sofern sie psychiatriekritisch Medikamente meiden – werden, wenn man sie lässt, Höchstleistungen zu Tieftstpreisen bringen, sich auf Zweierbeziehungsidyllen versteifen und ihren Alltag optimieren. Sie werden briefmarkenbreit dazugehören und deshalb umso ausschließender auf die reagieren, denen das versagt bleibt.
Die abseitigen ambivalenten Bereiche, die der strahlende König offenbar nicht darstellte, fanden bereits im alten Rom in Saturnalien ihren Ausdruck. Das setzte sich im Mittelalter in Narrenfesten und Karnevalsumzügen fort, die bis ins Heute reichen. Die gestaute Lust, der gestaute Frust konnten sich in anarchischen Ritualen entladen.
Gay Prides nur wenige 100 km östlich von Berlin werden zur Gefährdung für Leben und Gesundheit der Teilnehmer. In Amman oder Dhakar sind sie undenkbar. Pride Paraden von Behinderten und Verrückten in Vilnius, Havanna oder Maputo finden schon deshalb nicht statt, weil die Betreffenden nicht ausreichend mit Rollstühlen versorgt sind. Und wenn wir Pech haben, dienen sie wie die Saturnalien Roms auch der westlichen Welt lediglich als Ventil.