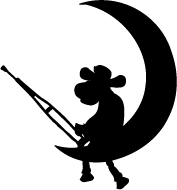Im Satiremagazin Titanic wird Rattelschnecks arm- und beinloser Comic-Held „Rümpfchen“ im Lampengeschäft vergessen und als besonders verrückte neue Designerkreation bewundert. In der nächsten Folge werden wir ZeugInnen von Rümpfchens erfolglosen Schwimmversuchen im Hallenbad. Darüber lachen gemeinhin nur die ganz hartgesottenen Fans des schwarzen Humors – oder behinderte …
Auch die LeserInnen dieser Zeitung werden zuweilen vielleicht ordentlich geschluckt haben ob der „bösen“ Selbstironisierung unserer Behinderungen. Warum eigentlich? Warum ist es immer noch „tabu“ über Behinderung zu lachen – und zu welchen Zeiten hatte man damit kein Problem? Warum und seit wann „dürfen“ das, wenn überhaupt, nur Behinderte selbst? Und wo sind da eigentlich die Grenzen – darf man bei Monty Pythons „Ministry of Silly Walks“ sich ordentlich auf die Schenkel hauen oder ist das eine zynische Verunglimpfung von Gehbehinderten? Solche Fragen beschäftigen die Rehabilitationswissenschaftlerin Claudia Gottwald in ihrem Buch „Lachen über das Andere“. Als kulturell-historische Analyse ist Gottwalds Buch in der mehrheitlich pädagogisch-medizinischen Wissenschaftsliteratur über Behinderung eine Rarität. Sie stellt ihre Arbeit in den Kontext der Disability Studies, einer noch jungen interdisziplinären Wissenschaftsrichtung. Diese untersucht die unterschiedlichen Bedeutungen, die dem (behinderten) Körper zugeschrieben werden und versteht Behinderung eher als soziales Produkt und nicht als rein körperliches Geschehen. Komisch ist, so schreibt der Philosoph Kuno Fischer 1889 in seiner Schrift „Über den Witz“, wenn ein „Objekt nicht im Einklange sondern im Widerstreit mit seiner Natur stehe“, also „verunstaltet“ und „hässlich“ sei. Waren die frühen Behindertenwitze meist bloße Verhöhnung dieses „Hässlichen“ und „Verunstalteten“, so zeigt er sich in der Moderne zunehmend als Infragestellung von gesellschaftlichen Normen und Regeln. Mit einem Streifzug durch die Philosophie des Humors zeigt Claudia Gottwald, wie der Behindertenwitz sich im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. Denn das Komische sei nur vor dem Hintergrund gemeinsamer Werte und Moral komisch – und verändert sich mit deren Wandel, so Gottwald. Auslöser des Lachens über körperliche und geistige Abweichung seien zum einen Ängste: Lachen sei die Kehrseite der Angst. Das Lachen wirkt gegen die Angst und erzeugt emotionale Distanz – man könne erst über etwas lachen, wenn man es als nicht (mehr) als bedrohlich empfindet. Zum anderen spielten Aggression, Überlegenheit und ein Triumph-Gefühl eine Rolle: Lachen über Devianz helfe, sich der eigenen Normalität zu versichern. ForscherInnen sprechen außerdem vom „Entlastungslachen“, das häufig vom Behindertenwitz ausgeht: Durch etwas Widersinniges wird Spannung erzeugt, die sich durch das Lachen löst. Das Lachen erlöst von verbotenen und sonst nur schwer erträglichen Ideen und Gefühlen. Der Witz hilft, sie zu bewältigen. Mit einer Vielfalt historischer Quellen zeigt Claudia Gottwald, dass das Lachen über Behinderung Tradition hat, immer normal war und ist, und doch seit einigen Jahrhunderten sanktioniert wird. Früher gehörten sie an jedes Adelshaus, das etwas auf sich hielt: Narren und Zwerge, manchmal auch Blinde, die zur Unterhaltung und Belustigung dienten oder auch mal als „Prügelknaben“ herhalten mussten. Sie hatten einerseits „Narrenfreiheit“, durften also aussprechen, was andere bei Hofe nicht zu sagen wagten, die meisten aber waren passives Objekt der Belustigung. Historiker unterscheiden zum Beispiel zwischen „natürlichen Narren“, die viele heute „geistig behindert“ nennen, und „Schalknarren“: Letztere hatten eher eine psychische Besonderheit, sie traten mit dem Publikum in Kontakt und banden es in die Inszenierung ein. Vom frühen Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert war das Lachen über „Missgestaltete“ erlaubt und üblich. Durch das Lachen über Behinderte wurde, so Gottwald, die ständische Ordnung gefestigt – Behinderte durften den Spott über bestimmte Stände darstellen, zum Beispiel den Klerus. Ab dem 18. Jahrhundert ziemte sich das Lachen über Behinderte nicht mehr. Behinderung wurde zunehmend als Unglück und Leiden betrachtet, wodurch es sich nicht mehr zu Unterhaltungszwecken eignete. Gefragt war Mitleid mit den armen Pechvögeln statt Spott – der war nur noch Kennzeichen des Pöbels, der Ungebildeten und Kinder. Es begann ein „Prozess der Regulierung und Zivilisierung des Lachens“, schreibt Gottwald: Je mehr über das Lachen über Behinderung reflektiert wurde, desto mehr wurde es begrenzt. Es wurden zunehmend Lachverbote ausgesprochen, oder zumindest differenziert, zum Beispiel zwischen „echten“ und „imitierten“ Behinderungen. Über letztere – also über den „buckligen“ Schauspieler mit Kissen auf dem Rücken – durfte gekichert werden. Es schickte sich aber nicht mehr, mit offener Überlegenheit oder Verachtung auf Behinderte hinunter zu blicken. Zeitgleich mit dem populär werdenden Blick des Mitleids wurden behinderte Menschen ab dem 18. Jahrhundert zunehmend für Medizin und Pädagogik interessant, vor allem auch die „Zwerge“ und „Narren“, die immer weniger öffentlich ausgestellt wurden. Statt Objekte der Komik seien sie nun Objekte der Medizin geworden, so Claudia Gottwald, und „behindert war nun der, über den nicht gelacht werden durfte“. Das frühere Verhältnis zu Behinderung wurde so zwar auf den Kopf gestellt, hatte aber mit einer Emanzipation Behinderter vom Status des verlachten Clowns oder Freaks wenig zu tun. Die Befreiung aus dem Objektstatus ließ noch etwas auf sich warten. Zwischen den 30er und den 70er Jahren waren Witze über Behinderung unüblich, berichtet Claudia Gottwald. Einzig über die Institutionen, die behinderte Menschen in dieser Zeit zunehmend verwahrten, wurden gerne Witze gerissen, zum Beispiel über die „Klapse“. Erst mit Aufkommen der Behindertenbewegung wurden behinderte Menschen selbst zu AkteurInnen des Witzes. Die meisten Witze, Comics, humorvollen Erzählungen über Behinderung stammen seitdem von Behinderten selbst. Die Subjekte des Behindertenwitzes haben sich ausgetauscht, so Gottwald: Wo früher der Adel lachte, kichern jetzt behinderte Menschen selbst, zum Beispiel über die TV-Comedy-Serie „Para-Comedy“ oder die behinderten Comic-Zeichner John Callahan und Phil Hubbe. Immer noch durchgängig als „nicht korrekt“ gelte allerdings das Lachen über Behinderte Menschen. Ob man demgegenüber über Behinderung lachen darf, das entscheiden behinderte Menschen mittlerweile selbst, und kehren so die Machtverhältnisse um, meint Claudia Gottwald: Behinderte selbst seien es, die dem heutigen Behindertenwitz seine Legitimation verleihten. Nur wenn die WitzeerzählerInnen selbst behindert sind oder anwesende Behinderte darüber lachten, trauten auch die Durchschnitts-Nichtbehinderten sich über Rümpfchen schlapp zu lachen. „Lachen über das Andere“ ist ein lesenswertes, reichhaltig mit historischen Beispielen illustriertes Buch. Als Doktorarbeit der Autorin ist es wissenschaftlich geschrieben – mal eben die rund 300 Seiten weg lesen wird da schwierig. Wenn man aber davon und vom Fehlen einer kulturvergleichenden Sicht auf das Thema absieht (was der Analyse dann auch noch einige hundert Seiten mehr hinzugefügt hätte) lohnt die Lektüre als detaillierter Einblick in ein Feld, in das sich vorher offenbar kaum jemand hinein gewagt hat.
Claudia Gottwald „Lachen über das Andere. Eine historische Analyse komischer Repräsentationen von Behinderung“. Bielefeld: Transcript, 2009, Reihe Disability Studies, 330 Seiten, 29,80 Euro._