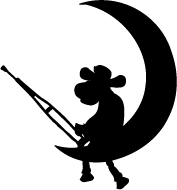Behinderung bedeutet in der öffentlichen und gesellschaftlichen Wahrnehmung meist Leiden, Qual und Rückschritt. Auch in den Medien werden diese Attribute häufig visuell umgesetzt, Behinderung bedeutet Nachteil, Not und beinhaltet die Notwendigkeit diese zu überwinden. Das Fantasiespektakel „Avatar“ von James Cameron zum Beispiel bewegt sich in diesen altbekannten Mustern.
Der Superheld nimmt es hier mit bösen Menschen auf, bekennt sich zur Natur, erweitert seine Seele und wird zum Kämpfer für Gerechtigkeit und Liebe. Wie jeder prototypische Held eines amerikanischen Fantasiefilms durchläuft er Etappen seiner emotionalen und sozialen Entwicklung mit Hilfe einer Frau, hier eines weiblichen Avatarwesens. In seiner menschlichen Existenz, die er mit Hilfe eines brutkastenähnlichen Gerätes immer wieder verlassen kann, ist unser Held auf den Rollstuhl angewiesen. Als Soldat ist er verletzt worden und jetzt sitzt er – typisch Querschnitt, doch passend zum Heldengenre – mit zu kräftigem Oberkörper in einem Rollstuhl. Leider bleibt dieser Rollstuhl kameratechnisch und erzählerisch weitestgehend ein ungenutztes Requisit. Was spielt seine Behinderung für eine Rolle? Wir sehen, dass er in seiner menschlichen Existenz Hilfe braucht, wenn er sich in den Apparat legen will oder in ein Flugzeug steigen muss. Das wird aber nicht weiter ausgeführt. Der Avatar des Soldaten lernt vielmehr mit seinen neuen körperlichen Gegebenheiten als Avatar umzugehen. Durch sie ist er übermenschlich groß, stark und kann drachenähnliche Tiere bezwingen und die Sprache der Natur verstehen. Er entfernt sich immer mehr von seiner menschlichen Existenz nun und verbringt die Zeit in seiner Parallelwelt, in der er weder Rollstuhl fahren noch essen oder trinken muss. Er spürt keine Schmerzen und kein Leid (außer das Leid der Natur). Er ist stark, intelligent und rücksichtsvoll, und er kämpft für seine Liebe gegen hässliche Urtiere und menschliche Soldaten, die mit roboterähnlichen Maschinen die Idylle des Planeten bedrohen. Aber stellen wir uns einmal vor, die kameragerechte Querschnittslähmung und der schnittige Sportrollstuhl wären durch die Transformationsmaschine nicht einfach so zum Verschwinden zu bringen und unser Soldat wäre auch in seiner Parallelwelt auf den Rollstuhl angewiesen. Sicherlich wären die zugegebenermaßen atemberaubenden Flug- und Kampfszenen schwerer zu inszenieren gewesen, aber stellen wir uns doch einfach mal vor, unser Soldat hätte auf seinem Flugsaurier eine Vorrichtung zur Befestigung seines Rollstuhls und statt mit Speeren gegen die bösen Soldaten zu kämpfen, wären aus den Griffen und Rädern Pfeile hervorgeschossen. Hätte sich die blaue Ureinwohnerin auch einen großen blauen Avatarrollstuhlfahrer verliebt? Die Frage kann man nicht beantworten. Nur einmal schimmert der Hauch einer Antwort kurz durch. Der Soldat wird von einem amerikanischen Bösen angegriffen und wird wieder zu seinem menschlichen Äquivalent. Die große blaue Geliebte nimmt den kleinen nun wieder behinderten hilfslosen Soldaten in die Arme und trägt ihn in das sichere Raumschiff und in die Verwandlungsmaschine. Leider bleibt es bei dieser leichten Andeutung der Behinderung, denn in der Avatarwelt ist alles perfekt und man braucht kein Leid, keine Krankheit, keine Schwäche. Man lebt im Einklang mit sich und der Natur. Behinderung, Krankheit und Andersartigkeit sind so unbrauchbar und überflüssig, wie das Aufnehmen von Nahrung. Aber braucht ein Superheld nicht sogar eine Schwäche? Ja, er braucht sie, schon, um sie bekämpfen, besiegen und überwinden zu können. Er braucht sie also, um sich überhaupt zum Helden machen zu können. Schade also, dass der wirklich dynamisch aussehende Sportrollstuhl in „Avatar“ lediglich eine winzig kleine Komparsenrolle bekommen hat. Vielleicht wäre dann diesem erzählerisch viel zu simpel gestrickten Hollywoodspektakel doch noch etwas abzugewinnen gewesen