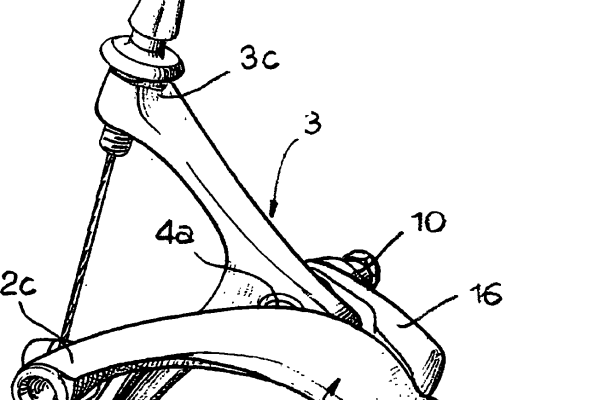Es ist schon sehr lange her, als man beim Trampen mit dem Rollstuhl von leeren LKWs mitgenommen wurde; heute kann man nicht einmal mehr spontan die Bahn nutzen. Ende der 70er war ich ein ganz junger Mann. Natürlich wollte ich leben – vor allem erleben. Dass ich aus meinem Rollstuhl nicht heraus konnte, änderte nichts daran. Samstag nach der Schule erzählte einer, dass in Gräfentonna eine Bluesband spielte. Eine solche war zu dieser Zeit in der DDR eine Rarität. Wir standen auf Blues. Also fuhren wir hin. Manne hatte einen E-Rolli, kam also alleine klar, und mich schob Harry, der halbwegs laufen konnte. Die letzten fünf km vom Bahnhof Gräfentonna zur Waldbühne mussten wir laufen, bzw. geschoben werden, weil es im Bus keinen Platz für unsere Rollstühle gab. Die Band spielte eine geile Mucke. Wir schüttelten unsere Mähnen und sangen inbrünstig mit, wenn wir einen Titel kannten. Am besten kam Manne. Er schaltete die Blinklichter an und fuhr mitten in die hottende Meute. Bald war er der Mittelpunkt des Open Airs. Den letzten Zug verpassten wir, weil es ja die fünf km Fußweg zurück gab. So verbrachten wir vier Stunden mit einer Flasche Wermut auf dem Provinzbahnsteig unterm Sternenzelt.
Den Begriff „barrierefrei“ gab es noch nicht. Aufzüge hatten nur Bahnhöfe in größeren Städten für die Transportfahrzeuge der Gepäckaufbewahrung. Mit dem Rollstuhl saß man im Gepäckwagen oder im Vorabteil am Ausstieg neben dem Klo. Trotzdem kamen wir immer an und fanden auch noch eine Übernachtung. Ich bin ein paar Mal sogar getrampt. Dazu eigneten sich nur LKWs mit leerer Ladefläche. Es klappte immer. Die meisten sagten, wenn sie unsere spontanen Unternehmungen mitkriegten: „Mensch, ihr seid ja mutig!“ oder „Ihr müsst doch wahnsinnig sein!“.
Fremde Leute packten ganz selbstverständlich mit an
Die Umwelt war in der DDR mehr noch als im Westen nicht auf Leute in Rollstuhl eingestellt. Diese bewegten sich meist auf gewohnten Wegen in einem engumgrenzten aber befahrbaren Terrain. Und Viele lebten fast ausschließlich in der Wohnung oder gar im Heim. Aber wenn dann mal einer am Bahnhof auftauchte, packten die Reisenden mit an und stemmten ihn in den Wagon. Dasselbe galt für die Treppen in die Wohnungen von Freunden, Kneipen, Kinos und Discos. In einer solchen Situation zu helfen, verstand sich von selbst.
Natürlich war es etwas anderes, wenn ein Behinderter mit im Haus wohnte und jeden Tag und vielleicht auch noch in der Nacht Treppenhilfe brauchte. Das wurde dann schon eher zur Last. Und wenn alle Rollstuhlfahrer auf die Idee gekommen wären, in ähnlich dreister Weise wie wir in die Öffentlichkeit zu drängen, hätten die Bürger einiges zu tragen gehabt.
Jetzt sind bald 40 Jahre vergangen, davon schon wieder zwei Jahrzehnte ohne DDR. Es gibt den Begriff „barrierefrei“ und sogar Entsprechungen in der realen Welt: Blindenleitsysteme, Einstiegshilfen, Aufzüge, Rollstuhltoiletten, -abteile, -tribünen, -eingänge.
Anfang des Jahres besuchten mich meine Eltern in Berlin. Ich wollte mit ihnen einen Abend in einem Varieté verbringen, das in den Hackeschen Höfen liegt. Diese sind für ihre rollstuhlfeindliche Architektur bekannt. So verwies ich, als ich die Karten telefonisch bestellte, darauf, dass ich ausreichend Hilfe dabei hätte, die Treppen mit dem Rollstuhl zu überwinden. Zu meiner Überraschung sagte man mir, dass es einen Aufzug gibt, ich aber die von mir soeben gebuchten Plätze in Bühnennähe nicht bekommen kann. Für Rollstuhlfahrer gäbe es nur Karten für die neunte und zehnte Reihe. Meine alten Eltern und ich, der sich nicht bewegen kann, um seinen Blickwinkel zu verändern, hätten von solchen Plätzen aus nur Andeutungen von Bewegungen der Artisten erahnen können. Ich diskutierte mit der Kartenverkäuferin. Aber sie sah keinen Weg. Ich würde den Kellnern im Wege stehen.
Das postete ich auf der Facebook-Seite des Varietés und sagte, dass diese Regelung diskriminierend sei. Sehr bald gab es empörte Kommentare. Die Geschäftsführung erklärte, dass sie mit dieser Regelung nicht hätten diskriminieren wollen, sondern dass sie dem Brandschutz geschuldet sei.
So erhielt ich dann doch die guten Plätze. Der Aufzug war an diesem Abend übrigens defekt. Aber ich war ja Kummer aus dem Osten gewohnt. Die Mitarbeiter des Hauses packten auch ganz selbstverständlich mit an, so dass meine Eltern ihre alten Knochen schonen konnten. Der Direktor spendierte uns sogar einen Chianti. Als dann meine Blase drückte, musste ich feststellen, dass ich nur über eine lange Treppe zur Toilette kam. Aber es gab noch eine: nur über zwei Stufen und einige verwinkelte Gänge, zu der das Personal uns führte. Leider war die für den Rollstuhl zu eng. Ich pinkelte in eine Flasche (habe ich immer dabei; bin ja Kummer gewohnt) und hatte einen schönen Abend mit Akrobatik auf Weltniveau und überraschend gutem Chianti.
Die Entdeckung der Diskriminierung
Der wäre ausgefallen, wenn ich nicht die Diskriminierung hätte ins Feld führen können. Im Rechtsstaat Bundesrepublik müssen, wenn ich ein Varieté besuchen möchte, Brandschutzverordnung, Bau- und Gewerberecht, Haftungsrecht und Antidiskriminierungsgesetz gegeneinander antreten.
In der Zeit, zu der ich als Tramper auf leere LKWs angewiesen war, entdeckten im Westen die Behinderten die Diskriminierung für sich.
Es war ein völlig neuer Gedanke, dass es eine Diskriminierung war, mit dem Bus als Rollstuhlfahrer nicht mitfahren zu können. Bisher bewältigte man das individuell und gegebenenfalls mit Hilfe der anderen Passagiere. Die Idee, dass andere Busse gebaut werden müssten, lag erst einmal sehr fern. Sie hat sich durchgesetzt.
Eine Gesellschaft darf heute auf keinen Fall diskriminierend sein. Deshalb sind entsprechende Gesetze entstanden und werden andere Busse gebaut. Auch der einzelne will auf keinen Fall als ein Diskriminierer gelten.
Frisst die Antidiskriminierung ihre Kinder?
Das hat meinen Eltern und mir den Abend gerettet. Es zeitigt aber auch Folgen, die selbst wieder ausgrenzend und diskriminierend sind. Spontanes Verreisen mit der Bahn ist für mich nicht mehr möglich. Ich muss Tage vorher die Tickets mit den Rollstuhlplätzen buchen und anmelden, wo ich ein- und aussteige. Tue ich es nicht, werde ich nicht mitgenommen, auch wenn die Mitpassagiere anpackten würden. Zudem ist die Bereitschaft der Leute dazu gesunken. Die Gesellschaft ist verantwortlich, nicht der Einzelne. Im Stadion sitze ich auf der Rollstuhltribüne, nicht im Fanblock, ebenso beim Rockkonzert, wo meine nichtbehinderten Freunde weit entfernt im Gewühl abtanzen. Mitunter bekomme ich auch im Puff zu hören, dass sie hier für mich nichts tun könnten. Für welche wie mich gäbe es doch eigens Sexualbegleiterinnen. Und aufs Männerklo werde ich auch nicht gelassen, wenn sich im Umkreis von 200 m eine Behindertentoilette befindet.
Offenbar scheint das Bemühen um das Aufheben von Ausgrenzungen neue zu schaffen. Die Antidiskriminierung frisst also ihre Kinder. Das liegt im Wesentlichen daran, dass die Maßnahmen, die Gleichberechtigung herstellen sollen, selbst wieder nur Sonderbehandlungen darstellen. Die Rollstuhltoilette steht eben nur gelegentlich zur Verfügung. Wirkliche Gleichbehandlung wäre der Umbau aller öffentlich zugänglichen Toiletten. Ein ICE verfügt über zwei bis vier Rollstuhlstellplätze. Eine extra Voranmeldung und Platzkartenreservierung wäre jedoch nur dann nicht nötig, wenn in jedem Wagon z.B. durch klapp- oder schwenkbare Sitzmodule mehrere Stellplätze geschaffen werden könnten und die Einstiegshilfen direkt am Wagon angebracht wären.
Barrierefreiheit ermöglicht erst dann in umfänglichem Sinn Teilhabe, wenn sie konsequent gedacht und umgesetzt wird. Da alle immer nur von den Kosten reden, ist es bis dahin noch ein weiter Weg – und der ist auf keinen Fall barrierefrei. Solange sind Improvisationen, Regelverletzungen und die gehörige Portion Frechheit für unsereins unabdingbar.