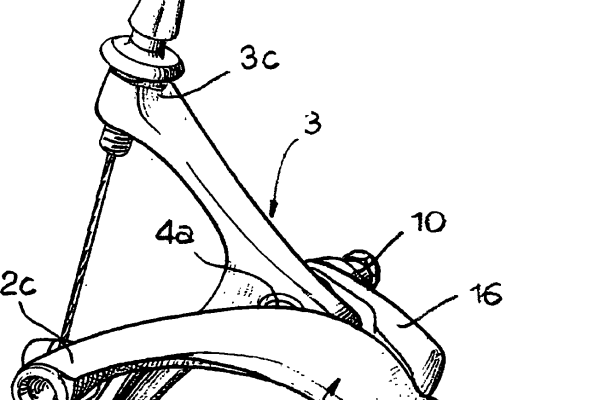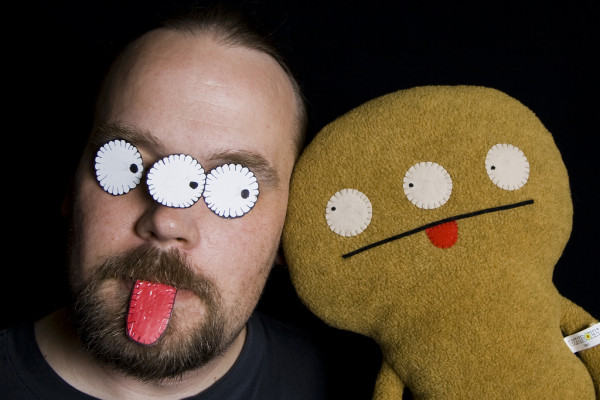Schwul, behindert und jüdisch: „Mein Mann nennt es meinen Nazi-Dreier“, sagt Fries und reißt den nächsten „schwarzen“ Witz über mangelnde Barrierefreiheit in Konzentrationslagern. Als der US-Amerikaner 1960 mit verdrehten und verkürzten Beinen geboren wurde, fiel seine Mutter in Ohnmacht und sein Vater lief schreiend durchs Krankenhaus: „Wir haben einen Freak bekommen!“ Als der Schock verdaut war, wurde ihr Sohn das erste behinderte Kind auf einer New Yorker Regelschule. Es folgten Literatur- und Theaterstudium, zahlreiche Essays, Gedichtbände, Theaterstücke und Anthologien. Momentan lebt Fries im kanadischen Toronto und unterrichtet Kreatives Schreiben. Sein aktuelles Buchprojekt führt ihn nach Deutschland. Für mondkalb wirft das einige Fragen auf.
mondkalb: Du schreibst oft autobiographisch. Wie wichtig ist Identität für deine Arbeit?
Kenny Fries: Anfangs habe ich bewusst über Identität geschrieben. In meinem ersten nichtfiktionalen Buch „Body Remember“ ging es viel um sich überkreuzende Identitäten. Ich versuchte davon ausgehend auf etwas Größeres zu kommen, auf das Verhältnis von Körper und Erinnerung – was in meinem Fall eben damit zu tun hat, schwul, jüdisch und behindert zu sein. In meinen anderen Büchern spielt das eine nicht ganz so zentrale Rolle. Aber es ist da – schließlich schreibe ich von meinem Standpunkt aus. Ich schreibe über Darwin aus der Perspektive eines Menschen mit Behinderung. Ich schreibe über Japan, und darüber, wie meine Behinderung mein Verständnis von dem, was dort passiert, beeinflusst. In meinem aktuellen Buch komme ich wieder auf Identität zurück und schreibe von meinen Erfahrungen in Deutschland.
mondkalb: Unter diesen drei Identitäten stellst du immer wieder Behinderung heraus. Ist die Identität „behindert“ deine Lieblingsidentität?
Es ist nie die Einzige. Ich sitze ja immer zwischen allen Stühlen. Wenn ich unter Behinderten bin, bin ich oft der Einzige, der schwul ist. Wenn ich unter Schwulen bin, sehe ich kaum mal jemanden mit Behinderung. Juden gibt es in den USA sehr viele, aber Leute wie ich tauchen da auch nicht so prominent auf. Interessanterweise wurde ich früher hauptsächlich als schwuler Schriftsteller gesehen. Mittlerweile werde ich eher als Schriftsteller mit Behinderung wahrgenommen. Aber ich selbst sehe mich einfach als Schriftsteller! Besonders in den USA wird jeder gleich in eine Nische gesteckt. Da es damals keine Behinderungs-Nische gab, steckte man mich in die schwule Nische. Für mich sind das alles Etiketten, die mir von außen gegeben werden. Die haben mit mir zu tun, aber sie definieren mich nicht.
mondkalb: Lass uns über Körper sprechen. Du hast gesagt, dass du in „Body Remember“ über die Beziehung zwischen Körper und Erinnerung schreibst. Was meinst du damit?
Viele meiner Erinnerungen werden durch Körperliches ausgelöst. Ich konnte zum Beispiel, als ich im College war, keine Freunde besuchen, die im Chemielaboratorium gearbeitet haben. Mein Körper hat sofort extrem reagiert, weil mich der Geruch der Chemikalien unmittelbar auf die Erinnerungen an meine Krankenhausaufenthalte als Kind zurückgeworfen hat. Wenn ich meine Narben anschaue oder andere sie berühren, dann bringt das Erinnerungen an Zeiten, in denen ich operiert wurde. In einem meiner Gedichte wird das dann zur Metapher: „Was ist eine Narbe, wenn nicht eine Wunde, die einst offen war“.
mondkalb: Wie kam es, dass du für deine neue Buchrecherche ausgerechnet nach Deutschland gegangen bist?
Als ich mein Visum bekam, hat mein Vater ungläubig gefragt: Wie, die lassen DICH rein? (Lacht.) Ein Grund, warum ich nach Berlin kommen wollte, war genau dieses Thema: Erinnerung. Hier gibt es so viel Erinnerung und Gedenken, nicht nur an die NS-Zeit, sondern auch an die DDR. Ich interessiere mich für Gesellschaften, die sich nach Zerstörung, nach einem Krieg, neu erfinden wollen. Was wird erinnert, was nicht, was wird verwischt, was verschwiegen, was wird abgerissen?
Früher habe ich, wenn ich Deutsche kennenlernte, mich immer als erstes gefragt: „Was haben deren Eltern und Großeltern im Dritten Reich, was haben sie im Krieg gemacht?“ Diese Fragen sind noch da, aber sie stehen nicht mehr im Vordergrund. Ich finde es vor allem interessant, wenn die Deutschen mit dem Thema anfangen. Meine Frage ist: Wie ist es für behinderte Menschen in einem Land zu leben, in dessen Geschichte sie als überflüssig galten? Ich habe eine meiner behinderten Interviewpartnerinnen gefragt, wann sie das erste Mal vom T4-Programm und der Euthanasie an behinderten Menschen in der NS- Zeit gehört und was sie dabei gedacht habe. Sie sagte, ihr habe das einen Anstoß gegeben, für ihre Rechte zu kämpfen. Auch ich erlebe auf der Straße manchmal Blicke, die mir wie Feindseligkeit, wie einen Wunsch nach Vernichtung vorkommen. Manche Leute mit Behinderung haben mir erzählt, dass ihnen gesagt wird: „Früher wärst du vergast worden“.
mondkalb: Du warst in verschiedenen identätspolitischen Bewegungen aktiv. Für welche Identität ist es am einfachsten zu kämpfen?
Das Jude-Sein war immer am einfachsten. Ich bin in New York aufgewachsen, wo um mich herum sehr viele Leute jüdisch waren, das war meine Community. Die Beschäftigung mit dem Schwul-Sein war unausweichlich. Ich musste mich mit mir als sexuellem Wesen auseinandersetzen. Mit meiner Behinderung hab ich mich erst nach meinem Coming Out beschäftigt. Bis vor vier Jahren habe ich keinen Rollstuhl, bis ich 28 war, nie einen Gehstock benutzt. Ich konnte ein paar Sachen nicht machen, aber das fand ich nicht schlimm. Obwohl ich kleinwüchsig bin, habe ich mich nie behindert gefühlt. Ich hab natürlich alle abwertenden Botschaften der Gesellschaft internalisiert: von Ärzten, von meiner Familie, von meinem Bruder. Aber erst als ich auf’s College ging, wurde mir das richtig klar. Die schwule Szene hingegen ist besessen von Aussehen und Attraktivität. Mein Ausgleich war dann immer, nett und schlau zu sein und den anderen zu gefallen, sie zu unterhalten. Die Behinderung aus dem Fokus der Aufmerksamkeit zu holen.
mondkalb: Gehst du zum Christopher Street Day oder auf andere Pride Parades?
Ich mochte Pride Parades nie besonders. Ich bin nicht gerade jemand, der auf die Barrikaden geht oder Unterschriften sammelt. Meine politische Aktion ist, überall da zu sein, wo jemand wie ich den normalen Ablauf durcheinander bringt – ob das nun eine Bank, die Uni, ein Toilettenraum, eine schwule Bar oder was auch immer ist. Ich bin so eine Art politisches Statement auf zwei Beinen, auch wenn ich mir dessen nicht immer bewusst bin.
Ich weiß, dass Pride Parade wichtig sind, ihre Kehrseite ist die Scham. Sie scheinen mir aber eine Art Überkompensation zu sein. Als ich jung war, bin ich hingegangen, aber mittlerweile interessieren sie mich nicht mehr. Die Paraden waren für mich eher eine Party, als dass ich mich da mit meiner Scham auseinandergesetzt hätte. Scham verschwindet nie ganz. Es ist eher so, dass man irgendwann vielleicht mehr Kontrolle über sie hat. Ich erlebe immer noch viele unangenehme Situationen, aber jetzt bin ich mir viel bewusster, worum es da geht, was da passiert.
mondkalb: Disability Pride Parades sind ja umstritten. Leute sagen: „Behinderungen bedeuten auch Leiden, das kann man doch nicht feiern.“ Kann man auf Behinderung stolz sein?
Das ist eine schräge Kritik. Nicht die Behinderung ist das Problem. Nur weil man eine stolze, selbstbewusste Haltung dazu hat, heißt das nicht, dass man sich über Leiden und Schmerzen freut. Es gibt schließlich viele Wege, mit Schmerz umzugehen. Warum sollte man überhaupt auf irgendwas stolz sein? Ich habe schon lange mit Depressionen zu kämpfen und nehme seit Jahrzehnten Medikamente dagegen. Bin ich stolz darauf, Depressionen zu haben? Natürlich nicht. Aber die Depression ist ein Teil von mir. Ich kann diesen Teil nicht aus mir heraus nehmen. Wer entscheidet, welcher Teil einer Persönlichkeit wichtig für einen ist und welcher nicht? Leute sagen, es ist cool, Motorrad zu fahren, aber nicht cool, Rollstuhl zu fahren. Wer entscheidet das?
mondkalb: Bei den Disability Pride Parades wird auch eine „Disability Culture“ gefeiert, eine Kultur der Behinderung. Auch da wenden Leute ein: „Eine lesbische und schwule Kultur, das kann man verstehen, die finden zum Beispiel auf den Parties Partner_innen. Aber eine Kultur behinderter Menschen? Dafür sind die doch alle viel zu verschieden …“
Mir ist eine Kultur von Behinderung sehr wichtig. Ich denke, ich arbeite mit meinen Büchern auch daran mit. Ich glaube, dass es eine Menge gibt, was behinderte Menschen verbindet. Leider sind das größtenteils Dinge, die mit ihrer Unterdrückung und Ausgrenzung zu tun haben, mit den Barrieren, die ihnen gegenüber stehen. Aber ist das nicht dasselbe wie bei anderen „Minderheitenkulturen?“ Ja, wir haben kein eigenes Essen, wir sprechen auch nicht eine andere Sprache. Aber wir behinderte Menschen teilen gemeinsame Erfahrungen. Auch wenn diese nur darin bestehen, dass wir alle an etwas gemessen werden, das wir nicht sind.
Das Interview führte Rebecca Maskos
Bücher von Kenny Fries:
The History of My Shoes and the Evolution of Darwin‘s Theory (2007)
Body, Remember: A Memoir (1997)
Staring Back: The Disability Experience from the Inside Out (1997)
Desert Walking: Poems (2000)
Anesthesia: Poems (1996)