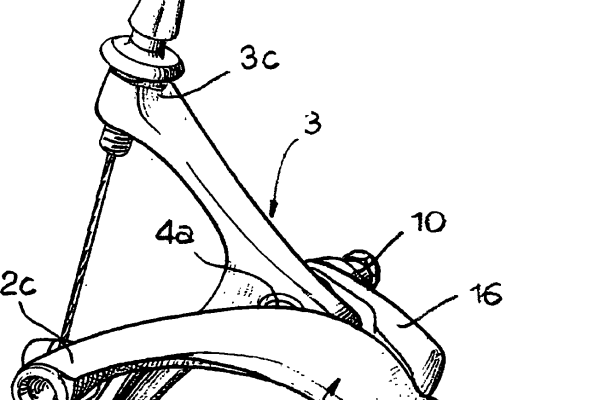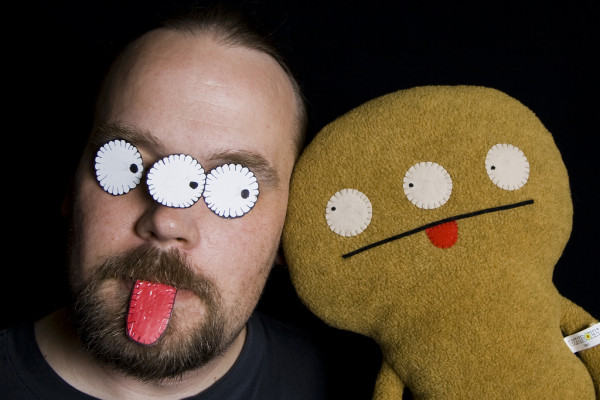Selbstbewusstsein und Behinderung
Hofnarrren, Zwerge, Mythen von Minotauren und Monster verweisen auf eine Geschichte, die zwischen dem 19. und der Mitte des 20. Jahrhunderts ihren Höhepunkt fand. Während dieser Zeit waren Freaks ein großes Geschäft. Freak Shows bevölkerten die USA, Menschen strömten in den Zirkus, die Völkerschauen, auf die Jahrmärkte. Sie kamen, um Freaks, Wilde und Sonderlinge zu begaffen. Sie kamen wegen des Nervenkitzels, aus Neugier, um sich ihres Selbstbildes zu versichern und um ihre Vorstellung von Normalität und Abnormalität bestätigt zu sehen. Doch wen starrten sie an? Die zahlenden Gäste sahen keine Launen der Natur. Vielmehr war die Freak Show eine ausgefeilte soziale Konstruktion, in deren Zentrum die Schausteller mit einer Mischung aus Kostümierung, Inszenierung und ausgefeilten Choreographien vier verschiedene Personengruppen in Freaks verwandelte.
Aus Behinderten wurden armlose Wunder, Froschmänner, Kamelfrauen, Riesen und Zwerge. Nichtbehinderte People of Color (POC) (2) aus den USA oder Kolonien wurden gekauft, überredet oder entführt und zu Kannibalen und Wilden gemacht. Aus nichtbe- hinderten amerikanischen POC wurden Eingeborene der exotischen Wildnis. Aus Menschen mit sichtbaren Eigenheiten, bärtigen oder besonders dicken Frauen, extrem dünnen Männer, Tätowierten und Intersexuellen, wurden sonderbare Ausstellungsstücke. Diese Menschen waren nicht von Natur aus Freaks, die Freak-Show hat sie dazu gemacht, indem sie sorgfältig die Unterschiede zwischen dem Normalen und dem Anderen konstruierte und hervorhob.
Dennoch, Freaks waren nicht einfach Opfer. Besonders jene, die nicht geistig behindert waren oder aus Afrika, Asien, von Pazifikinseln oder aus Lateinamerika verschleppt wur- den, hatten oft Einfluss auf ihre Darstellung. Viele arbeiteten gemeinsam mit ihren ManagerInnen an profitablen Vorstellungen. Einige hatten ein annehmbares Einkommen, einige wie Charles Stratton oder Mercy Lavinia Warren Bump wurden sogar reich. Wieder andere, wie die Hilton Schwestern, wurden ihre eigenen Managerinnen oder gründeten Ensembles. Oft waren in der Freak Show-Kultur die Zuschauer die „Opfer“, die belogen und bestohlen wurden, denen himmelschreiende Summen für Tand abgeknöpft und die an der Kasse beim Wechselgeld betrogen wurden.
Ausbeutung und Macht
Robert Bogdan zitiert in „Freak Show“ (3) einen Brief von Ward Hall: „Ich habe über Jahre Freaks ausgestellt und ausgebeutet. Jetzt beutet ihr sie aus. Der Unterschied zwischen Autoren, den Medien und den früheren Freak Shows ist: Wir haben sie bezahlt!“ Hall verwendet „ausbeuten“ ironisch. Er glaubt nicht, dass er Freaks ausgebeutet hat, er hatte eine Geschäftsbeziehung. Dennoch ist seine Antwort zu einfach. Vielleicht hat er nicht aus Hass auf Behinderte gehandelt. In jedem Fall hat er, wie alle, die von der Freak Show profitierten, Ableism und Rassismus zu seinem Vorteil genutzt. In vielerlei Hinsicht ähnelt das dem Job von Prostituierten. Joanna Kadi schreibt: „Linke Klassenanalyse sieht Prostitution im Kontext von Kapitalismus (ein weiterer wirklich mieser Job), sie feiert die Frauen, die ihn überleben und dreht der moralisierenden Mittelschichts-Attitüde, die verurteilt ohne zu verstehen, eine Nase.“
Auch die Arbeit als Freak war ein mieser Job, oft der einzig verfügbare.
Der Niedergang der Freakshow
In der Blütezeit der Freakshow existierte das heutige medizinische Modell von Behinderung nicht. Der Niedergang der Freak Show Anfang des 20. Jahrhunderts fiel mit der Medikalisierung von Behinderung zusammen. Als Mitleid und Diagnose auf den Plan traten, verschwanden Reiz und Geheimnis von Behinderung. Die Verächter der Freak Show nehmen an, dass die „bad old days“ – die schlechten alten Zeiten – wirklich schrecklich gewesen sein müssen. Ich bin da nicht so sicher.
Das Ende der Freakshow war das Ende einer bestimmten Beschäftigung für alle, die als Freaks arbeiteten. Für Behinderte war das Ende der Freakshow die Garantie für Arbeitslosigkeit. Otis Jordan, ein behinderter Afroamerikaner, trat in der Sutton Sideshow, der letzten verbliebenen Freakshow, als „Froschmann“ auf. 1984 wurde sein Auftritt auf der New York Statesfare (einem jährlich stattfindenden Volksfest) untersagt, nachdem es Beschwerden über die entwürdigende Zurschaustellung von Behinderten gab. „Was zur Hölle will sie (die Frau, die sich beschwert hatte) von mir? Dass ich ein Sozialfall werde?“, antwortete Otis darauf. Als Freak zu arbeiten mag ein mieser
Job gewesen sein, aber es war immerhin ein Job.
Freak Shows heute
Das Ende der Freakshow bedeutete nicht das Ende des Voyeurismus. Wir haben nur
eine Form des Freakseins gegen eine andere eingetauscht. Man nehme das öffentliche Ausziehen von behinderten Kindern. Sie müssen sich vor Gruppen von ÄrztInnen und MedizinstudentInnen bis auf die Unterwäsche entblößen. Die ÄrztInnen lassen das Kind hin und her laufen, drücken seine Muskeln, analysieren seine Gangart, messen seine Schritte und die Beugung des Rückens. Sie machen Notizen und sprechen untereinander darüber, welche Operationen und Behandlungen sie empfehlen.
Freak-Shows spielen sich heute in Krankenhäusern ab, in Spendenkampagnen, wenn Geld aus Mitleid gemolken wird. Freaksein wird in Heimen gemacht, in denen Behin- derte und Alte gegen ihren Willen leben. Es lauert an Bushaltestellen, auf Spielplätzen und in Restaurants. Es geschieht, wenn Nichtbehinderte glotzen und dabei so tun, als schauten sie weg. Die Freak Show geschieht ständig, ohne dass wir dafür bezahlt werden. über die heutige Freakshows haben wir keine Kontrolle mehr. Die Darstellung von Behinderung wird von Medizin und Wohltätigkeitsindustrie kontrolliert. Zumindest war es so, bis die Behindertenrechtsbewegung auf den Plan trat.
Pride
Sie schuf eine neue Definition von Selbstbestimmung, bot Unterstützung und arbeitete als Interessenvertretung. Sie war die Kraft, die das Freaksein zurückeroberte und dafür sorgte, dass behinderte Menschen im Mittelpunkt stehen, wenn es darum geht Behinderung zu definieren. Pride (im Deutschen: Stolz bzw. Würde, Selbstbewusstsein) ist ein wichtiger Teil davon. Ohne Selbstbewusstsein ist es viel wahrscheinlicher, dass Behinderte die Gegebenheiten einer ableistischen Gesellschaft akzeptieren: Erwerbslosigkeit, Armut, Absonderung und mangelhafte Ausbildung, jahrelang in Heimen weggesperrt zu werden, Gewalt durch Betreuende und Ausgrenzung zu erfahren. Ohne Selbstbewusstsein wird Widerstand gegen Unterdrückung nahezu unmöglich. Aber: Disability-Pride, Selbstbewusstsein behinderter Menschen, ist nicht so einfach zu schaffen. Behinderung ist in der Isolation verwurzelt, in Scham getränkt und in Schweigen gehüllt.
Als ich 1969 in der hintersten Provinz Oregons nach einem langen Kampf mit der Schulverwaltung, die mich in eine Sonderschulklasse stecken wollte, in die Regelklasse eingeschult wurde, gelang das nur, weil ich beim IQ-Test gut abschnitt, weil mein Vater den Direktor kannte und der Grundschullehrer sich für mich einsetzte. Ab Mitte der Achtziger Jahre war die gemeinsame Beschulung selbst in kleinen Gemeinden keine Seltenheit mehr. Aber 1969 war ich der erste. Niemand, wusste wie man mir umgehen sollte. Deshalb ignorierten alle meine Behinderung. Wenn ich einen Test nicht in der vorgeschriebenen Zeit beenden konnte, bestanden meine Lehrer darauf, dass ich ihn unvollendet abgab. Wenn ich als Idiotin, Affe, Depp bezeichnet wurde, unterstützte mich niemand. Ich wurde zur Außenseiterin. Zur Wehr setzen musste ich mich ohne Hilfe von Erwachsenen. Von den Förderkindern in der Schule distanzierte ich mich so weit wie möglich. Ich wollte „normal“ sein, als nichtbehindert durchgehen, obwohl es unmöglich war, meine zitternden Hände und mein Nuscheln zu übersehen.
Mary Walls kam in der vierten Klasse zu uns. Sie hatte Hörgeräte für beide Ohren, wir gingen zum gleichen Logopäden. Heute wünsche ich, wir wären Freundinnen geworden, stattdessen wurden wir Feindinnen. Mary war darauf angewiesen, Lippen zu lesen. Die Cerebralparese beeinflusst meine Sprache, meine Lippen sind kaum zu lesen. Sie machte sich vermutlich aus Frustration über mich lustig und ich jagte sie wie kaum einen meiner anderen Peiniger. Heute verstehe ich diese „horizontale Feindschaft“: Schwule und Lesben, die Bisexuelle verachten; Transsexuelle, die Drag Queens ablehnen; ArbeiterInnen, die auf Arme herabschauen.
„Pride“ arbeitet gegen diese verinnerlichte Unterdrückung. Selbsthass in „Pride“ zu verwandeln ist eine wesentliche Form des Widerstands. Manchmal können die Worte
des Hasses und der Gewalt neutralisiert oder in selbstbewusste Bezeichnungen verwandelt werden. Dem Peiniger, der „Krüppel“ ruft, und dem Schwulenhasser, der das Wort queer wie einen Knüppel schwingt, lässt sich entgegenhalten: „Ja, Du hast recht. Ich bin queer, ich bin ein Krüppel. So what?“ und damit die Macht derer untergraben, die uns am liebsten tot wüssten.
Um jeden Verdacht auszuräumen, ich glaube nicht, dass Lesben, bisexuelle, schwule und Transpersonen, die den Begriff „queer“ ablehnen, Behinderte, die mit Krüppel nichts anfangen oder Schwarze, die „Nigger“ zurückweisen, in ihrer verinnerlichten Unterdrückung gefangen sind. Das wäre viel zu einfach. Trotzdem stelle ich mir die Frage: Was verstört MICH an dem Wort Freak?
Der Schatten der Freak Show
Auch wenn die Antwort auf die Frage nach dem Wort Freak nicht mit Selbsthass zu beantworten ist, muss ich den Blick meines Ichs bannen, des Ichs, das „normal“ sein will, des Kindes, das meinte, als nichtbehindert durchgehen zu sollen, des Krüppels, der sich immer noch dafür geniert, wie sich sein Körper bewegt. In den letzten zehn Jahren habe ich unter Behinderten Zorn und Subversion gelernt. Bisher bin ich nicht so weit, meine Cerebralparese selbstbewusst zu zeigen, obwohl das ein Mittel ist, das viele Akti- vistInnen nutzen. Sie sagen: „Ja verdammt, schau genau hin. Schau auf mein Humpeln, meinen zuckenden Körper, meine verkümmerten Beine. Höre auf die Gebärdensprache meiner Hände, die Du noch nicht einmal verstehst. Sieh meine milchigen Augen, ich verstecke sie nicht länger hinter eine Sonnenbrille. Obwohl Du mich jahrelang angegafft hast, hast Du mich nicht gesehen.“ Ist dies Zeigen dasselbe wie pride? Jedes Mal, wenn ich Behinderte sich selbst Freak nennen höre, stoßen mein neu gewonnener Stolz und mein jahrzehntealter Selbsthass zusammen.
Für mich ist Freak mit heutigem Freaksein verbunden. Mit Angegafftwerden, das so häufig passiert, dass ich es nicht einmal mal mehr wahrnehme. Ich sehe sie nicht, – neugierig, verstört, ängstlich ihre Hälse nach meinen zitternden Händen und meinen ruckartigen Bewegungen verdrehen. Ich habe vor langer Zeit begonnen, diese übergriffe abzuwehren. Ich weiß nur, dass sie geschehen, weil mir meine FreundInnen davon erzählen. Ich weiß, dass mir diese Blicke in Fleisch und Blut übergegangen sind.
Das Wort Freak ist für mich außerdem von der schwierigen kollektiven Geschichte der Freak Shows überschattet. Mir gefällt die Vorstellung, dass Menschen einst Vorteil aus der Schaulust von Weißen und Nichtbehinderten gezogen haben, dass Behinderte Geld dafür bekamen, ihre Behinderung auszustellen und zu übertreiben. Andererseits hasse ich die Art und Weise, wie Freak Shows die Lügen über Behinderte und nichtbehinderte POC verstärkten. Verleugnen Behinderte, wenn sie sich heute als Freaks bezeichnen, diesen Teil der Geschichte? Indem man sie nur als Widerstandsgeschichte erzählt, wird an die Hilton Sisters oder an das behinderte Mädchen erinnert, dass während der Vorstellungen das Publikum beschimpfte. Was ist mit den anderen? Was ist mit Maximo und Barthola, den geistig behinderten Zwillingen, die als Kinder entführt und als Barbaren nackt zur Schau gestellt wurden. Was ist mit den nichtbehinderten POC die einsam und fern ihrer Heimat in den Freak Shows starben? Wenn wir uns Freaks nennen, vergessen wir dann den Teil der Geschichte, der Erinnerung und nicht Stolz verlangt?
Ich erwarte keine Antwort. Egal ob ich mich Freak nenne oder nicht, ich habe viel mit Otis Jordan oder Daisy Hilton gemein. Ich möchte die Welt verändern, so dass nie wieder Anthropologen Lügen über die Körper von Maximo und Barthola verbreiten, dass nie wieder behinderte Kinder öffentlich ausgezogen werden. Egal wie wir uns nennen, wie wir unseren Selbsthass, unsere Scham, unsere Schweigen und unsere Isolation zer- stören, das Ziel ist das gleiche: unsere alltägliche materielle Unterdrückung zu beenden.
Übersetzung: Stefan Gerbing
Eli Clare ist ein queerer Transmann, Lyriker, Schriftsteller und Aktivist mit Behinderung. Er hat viele Texte, Gedichte und zwei Bücher veröffentlicht: „Exile and Pride. Disability, Queerness and Liberation“ und „The Marrows Telling“ (Gedichtsammlung). Eli Clare lebt in Vermont auf dem Land. Wir veröffentlichen hier einen Ausschnitt aus „Exile and Pride“ (1999, South End Press, Seite 71ff). Mehr Informationen über Eli Clare unter: www.eliclare.com
Nachweise:
(1) Der Begriff „pride“ ist schwer ins Deutsche zu übersetzen: „Stolz“ trifft die englische Bedeutung nicht ganz. Wir schlagen „Selbst- bewusstsein“ vor.
(2) Bogdan, Robert (1988): Freak show. Pre- senting human oddities for amusement and profit. Chicago, S. 136.
(3) Kadi, Joanna (1996): Thinking class. Sketches from a cultural worker. Boston, S. 103.